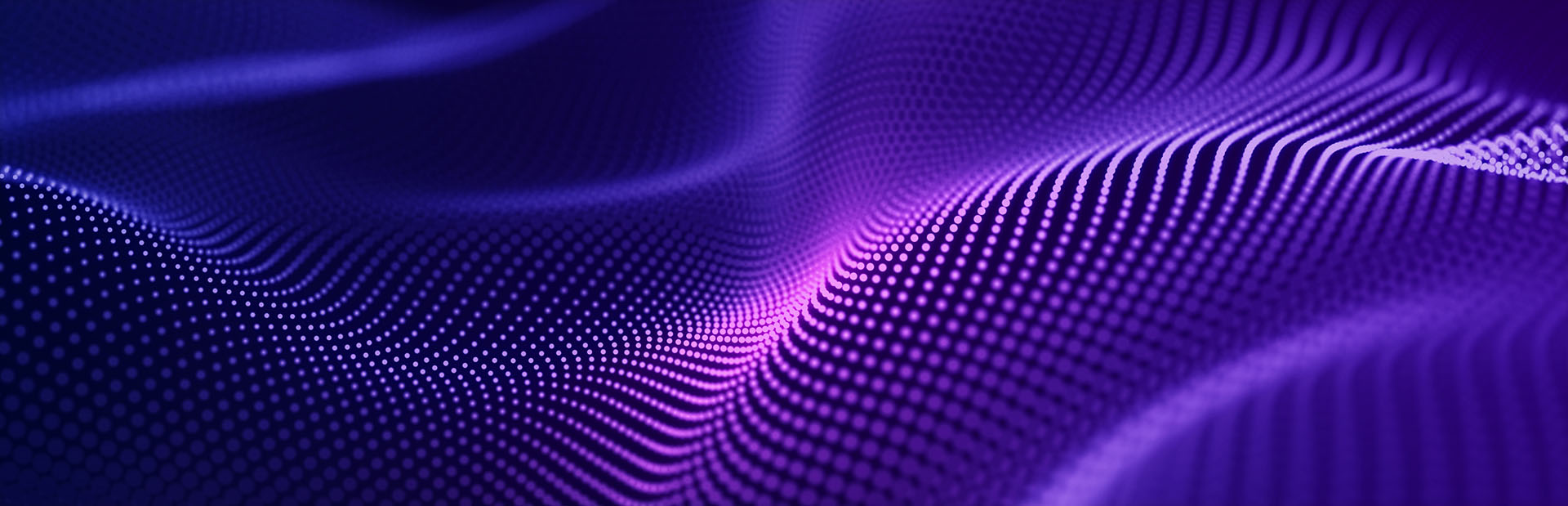Hauptansprechpartner
Am 1. Januar 2021 ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) in Kraft getreten. Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen führt zu einer tiefgreifenden Änderung der deutschen Restrukturierungslandschaft: Das StaRUG bietet erstmals einen gesetzlichen Rahmen zur Sanierung drohend zahlungsunfähiger Unternehmen außerhalb der Insolvenz. Diese können mithilfe eines Restrukturierungsplans Sanierungen unter Einbeziehung von Gläubigern auch gegen den Willen Einzelner umsetzen.
Mit dem StaRUG wird die EU-Restrukturierungsrichtlinie, Richtlinie (EU) 2019/1023, in deutsches Recht umgesetzt. Die EU-Restrukturierungsrichtlinie verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten, einen vorinsolvenzlichen Restrukturierungsrahmen zur Abwendung einer wahrscheinlichen Insolvenz zu schaffen.
- Wesentliche Neuerungen durch das StaRUG
- Krisenfrüherkennung, Krisenmanagement und Haftungsrisiken
- Sanierungsoptionen
- Restrukturierungsplan
- Flankierende Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens
- Durchführung eines gerichtlichen Planabstimmungsverfahrens
- Gerichtliche Vorprüfung von Fragen betreffend den Restrukturierungsplan
- Gerichtliche Stabilisierungsanordnung
- Gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans
- Anzeige des Restrukturierungsvorhabens beim Restrukturierungsgericht
- Pflichten und Haftung ab Anzeige des Restrukturierungsvorhabens
- Sanierungsmoderation
- Das StaRUG – Bedeutung für Schuldner und Gläubiger kurzgefasst
- Unsere Expertise im Bereich Restrukturierung und Insolvenz – Ihr Vorteil
Wesentliche Neuerungen durch das StaRUG
Das StaRUG stellt Unternehmen in der Krise ein Instrumentarium zur Verfügung, durch das sie sich restrukturieren können, ohne – wie bei der Insolvenz – ein formales Verfahren eröffnen zu müssen. Kernelement des StaRUG ist der Restrukturierungsplan, der die wesentlichen Maßnahmen der Sanierung regelt und der im Grundsatz ohne gerichtliche Beteiligung aufgestellt und in Kraft gesetzt werden kann. Das Unternehmen wählt – in den Grenzen des Gesetzes – aus, welche Gläubiger einbezogen werden. Flankierend dazu bietet das StaRUG einen Werkzeugkasten von Instrumenten, die die Aufstellung und Umsetzung des Restrukturierungsplans erleichtern sollen.
Das StaRUG eignet sich vornehmlich für die finanzielle Restrukturierung von Unternehmen, wie z. B. einen Schuldenschnitt.
Darüber hinaus führt das StaRUG eine rechtsformübergreifende, gesetzlich normierte Pflicht der Geschäftsleitung zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement ein.
Krisenfrüherkennung, Krisenmanagement und Haftungsrisiken
Krisenfrüherkennung als Pflicht der Geschäftsleitung
Nach § 1 StaRUG haben Geschäftsleiter fortlaufend über Entwicklungen zu wachen, die den Fortbestand der juristischen Person gefährden könnten. Das StaRUG verpflichtet die Geschäftsleitung damit unabhängig von der Größe und der Branche des Unternehmens, ein Krisenfrüherkennungssystem zu errichten. Das heißt: Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstände einer AG müssen in der Lage sein, laufend die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und das Nichtvorliegen einer Überschuldung prüfen.
Wie das Krisenfrüherkennungssystem nach dem StaRUG genau ausgestaltet sein muss, schreibt das Gesetz nicht vor. In § 101 StaRUG wird allerdings darauf hingewiesen, dass Informationen zur frühzeitigen Identifizierung von Krisen vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unter der Internetadresse www.bmjv.bund.de bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich allerdings um einen sehr allgemeinen Verweis auf die generellen Hilfs- und Beratungsangebote.
Zentrales Element des Krisenfrüherkennungssystems ist die Liquiditätsplanung des Unternehmens für die nächsten 24 Monate, die jeder Geschäftsleiter für sein Unternehmen unabhängig von Branche und Größe aufstellen sollte. Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Krisenfrüherkennungssystems sollten in das Compliance-System des Unternehmens integriert werden.
Geeignetes Krisenmanagement
Zeichnet sich eine Krise ab, muss die Geschäftsleitung geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen und unverzüglich den zur Überwachung der Geschäftsleitung berufenen Organen – typischerweise dem Beirat oder Aufsichtsrat – berichten.
Welche Maßnahmen die Geschäftsleiter zur Überwindung der Krise umsetzen, können sie im Rahmen des ihnen zustehenden Beurteilungsspielraums entscheiden. Die Geschäftsführer einer GmbH haben hierbei die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes walten zu lassen; Vorstandsmitglieder einer AG haben die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters zu beachten. Der jeweilige Sorgfaltsmaßstab bestimmt sich nach den Steuer-, Straf-, Arbeits- und sonstigen Gesetzen sowie den gesellschaftsrechtlichen (Treue-)Pflichten gegenüber dem Unternehmen.
Berühren die Maßnahmen die Zuständigkeiten anderer Organe, z. B. einer Gesellschafterversammlung einer GmbH, muss der Geschäftsleiter zumindest unverzüglich auf deren Beschlussfassung hinwirken. Der im Gesetzesentwurf vorgesehene sog. „shift of duties“ wurde in der finalen Version des StaRUG gestrichen. Der „shift of duties“ sah vor, dass Geschäftsleiter ab dem Eintritt der drohenden Zahlungsunfähigkeit vornehmlich im Interesse der Gläubigergesamtheit zu agieren haben und entgegenstehende Weisungen der Gesellschafter unbeachtlich sein sollen. Dies hätte für Geschäftsleiter immense Haftungsrisiken bedeutet.
Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Aufsichtsorgane
Inwiefern Verstöße gegen die Pflicht zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement im Sinne des § 1 StaRUG in der Praxis tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Haftung auslösen, bleibt abzuwarten. Allerdings sind Insolvenzverwalter im Falle des Scheiterns einer Restrukturierung verpflichtet, mögliche Haftungsansprüche der Gesellschaft gegen Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane zu prüfen und durchzusetzen.
Um sich vor einer möglichen Haftung gegenüber der Gesellschaft für Fehler bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Krisenbewältigung und der Inanspruchnahme des unternehmerischen Ermessensspielraums zu schützen, sollten Geschäftsleiter dokumentieren, dass sie vernünftigerweise annehmen durften, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Die im Aktienrecht geregelte Business Judgement Rule ist hier grundsätzlich auch für Geschäftsleiter anderer Gesellschaftsformen wie beispielsweise der GmbH anwendbar. Bei Unsicherheit darüber, ob (noch) eine unternehmerische oder (schon) eine rechtliche Entscheidung zum Gegensteuern in der Krise zu treffen ist und die Business Judgement Rule überhaupt Anwendung findet, steht Ihnen CMS gerne als fachkundiger Berater zur Seite.
Näheres zur Pflicht zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement von Geschäftsleitern finden Sie in unserem Blog-Beitrag.
Zur Vermeidung von Haftungsrisiken sollten Geschäftsleiter vor der Einleitung eines StaRUG-Verfahrens (ebenso wie vor der Stellung eines Insolvenzantrags wegen drohender Zahlungsunfähigkeit) einen Gesellschafterbeschluss einholen.
Sanierungsoptionen
Das StaRUG schafft Werkzeuge für eine vereinfachte Restrukturierung drohend zahlungsunfähiger Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahrens. Es schließt damit die Lücke zwischen der freien vorinsolvenzlichen Sanierung und der Sanierung über ein (gerichtliches) Insolvenzverfahren.
Restrukturierungsplan
Grundlage für eine nachhaltige Sanierung unter Nutzung des StaRUG ist der Restrukturierungsplan (§§ 2 ff. StaRUG). In diesem wird festgelegt, in welche Rechte von Gläubigern zur Sanierung des schuldnerischen Unternehmens eingegriffen werden soll. Anders als im gerichtlichen Insolvenzplanverfahren müssen in einen Restrukturierungsplan nicht sämtliche Gläubiger und Anteilsinhaber einbezogen werden. Vielmehr entscheidet der Schuldner über die sachgerechte Auswahl der Planbetroffenen.
Der Restrukturierungsplan ermöglicht eine weitreichende Umgestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern. Es können Forderungen gegen den Schuldner, Sicherungsrechte sowie bestimmte gruppeninterne Drittsicherheiten zur Disposition gestellt werden. Daneben können auch die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der am Schuldner beteiligten Personen im Restrukturierungsplan gestaltet werden, sodass neben der Neuordnung der Verbindlichkeiten flankierende gesellschaftsrechtliche Maßnahmen vorgesehen werden können. Auch können in den Restrukturierungsplan weitere begleitende Maßnahmen aufgenommen werden, etwa die Zusage neuer Finanzierungen.
Die Gestaltungsmacht des Restrukturierungsplans ist allerdings nicht unbegrenzt. Ausgenommen sind vor allem Rechte von Arbeitnehmern (siehe hierzu unseren Blog-Beitrag). Dies sollte bei der Auswahl der geeigneten Verfahrensart für eine geplante Sanierung beachtet werden.
Damit durch den Restrukturierungsplan in die Rechte der Gläubiger und der Anteilsinhaber eingegriffen werden kann, müssen die Planbetroffenen ihn zunächst annehmen. Hierzu werden aus den Planbetroffenen mit vergleichbarer Rechtsstellung Gruppen gebildet, die über den Plan abstimmen. Der Restrukturierungsplan muss sämtliche Informationen enthalten, die für die Entscheidung der planbetroffenen Gläubiger über die Planannahme erheblich sind; dazu gehört insbesondere eine Vergleichsrechnung, in der die Situation der Planbetroffenen mit Plan der Situation derer ohne Plan gegenübergestellt wird. Für die Annahme des Restrukturierungsplans ist grundsätzlich erforderlich, dass alle Gruppen dem Restrukturierungsplan zustimmen. Hierfür ist erforderlich, dass in jeder Gruppe Gläubiger mit mindestens 75 % aller Stimmrechte den Plan annehmen. Unter gewissen Voraussetzungen kann die fehlende Zustimmung einer Gruppe entbehrlich sein.
Flankierende Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens
Unternehmen werden durch das Gesetz Instrumente zur Verfügung gestellt, die nach dem Baukastenprinzip flexibel und unabhängig voneinander genutzt werden können:
Durchführung eines gerichtlichen Planabstimmungsverfahrens
Der Schuldner entscheidet, ob die Abstimmung über den Restrukturierungsplan außergerichtlich stattfindet oder ob ein gerichtliches Planabstimmungsverfahren durchgeführt werden soll. Stellt der Schuldner den Antrag auf Durchführung des gerichtlichen Planabstimmungsverfahrens; bestimmt das Restrukturierungsgericht einen Erörterungs- und Abstimmungstermin, zu dem alle Planbetroffenen zu laden sind. Durch eine Abstimmung über den Restrukturierungsplan im gerichtlichen Verfahren werden beispielsweise rechtliche Unsicherheiten vermieden, die bei einer außergerichtlichen Planabstimmung entstehen können (z. B. Nachweisrisiken). Im Übrigen entspricht das gerichtliche Abstimmungsverfahren weitestgehend der außergerichtlichen Abstimmung.
Gerichtliche Vorprüfung von Fragen betreffend den Restrukturierungsplan
Auf Antrag kann das schuldnerische Unternehmen eine gerichtliche Vorprüfung erheblicher Fragen durchführen lassen; und zwar selbst dann, wenn die Abstimmung über den Restrukturierungsplan im außergerichtlichen Verfahren durchgeführt wird. Ziel der gerichtlichen Vorprüfung ist es, etwaige rechtliche Unsicherheiten im Zuge der außergerichtlichen Planabstimmung zu beseitigen; wie z. B. bezüglich der Einhaltung von Verfahrensvorschriften oder der rechtmäßigen Gruppenbildung.
Gerichtliche Stabilisierungsanordnung
Soweit für das Erreichen des Restrukturierungsziels erforderlich, ordnet das Restrukturierungsgericht auf Antrag des Schuldners eine Vollstreckungs- und Verwertungssperre an (sog. Stabilisierungsanordnung). Dies bedeutet, dass Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner untersagt oder einstweilen eingestellt werden. Rechte an Vermögensgegenständen dürfen von den Gläubigern nicht durchgesetzt werden. Der Schuldner darf die entsprechenden Gegenstände in diesem Fall weiter einsetzen, soweit sie zur Fortführung des Unternehmens von erheblicher Bedeutung sind. Die Stabilisierungsanordnung kann grundsätzlich für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten angeordnet und unter bestimmten Voraussetzungen auf insgesamt maximal acht Monate verlängert werden.
Gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans
Auf Antrag des Schuldners bestätigt das Restrukturierungsgericht nach der Annahme durch die Gläubiger den Restrukturierungsplan. Die Folge: Alle im gestaltenden Teil des Plans festgelegten Maßnahmen wirken gegenüber allen Planbetroffenen. Dies gilt auch gegenüber den Planbetroffenen, die nicht an der Abstimmung über die Annahme des Plans teilgenommen oder gegen dessen Annahme gestimmt haben.
Anzeige des Restrukturierungsvorhabens beim Restrukturierungsgericht
Die flankierenden Instrumente können Schuldner zur Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist die Anzeige des Restrukturierungsvorhabens bei dem Restrukturierungsgericht.
Pflichten und Haftung ab Anzeige des Restrukturierungsvorhabens
Vom Zeitpunkt der Anzeige des Restrukturierungsvorhabens bei dem zuständigen Restrukturierungsgericht an müssen die Geschäftsleiter des Unternehmens die Restrukturierungssache mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Sanierungsgeschäftsführers betreiben und dabei die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger wahren. Verletzen die Geschäftsleiter diese Pflichten, sind sie dem Unternehmen zum Ersatz des den Gläubigern daraus resultierenden Schadens verpflichtet. Schadensersatzansprüche können dabei nur durch das Unternehmen selbst (sog. Innenhaftung), nicht durch die Gläubiger des Unternehmens geltend gemacht werden.
Die Insolvenzantragspflicht nach § 15 a InsO wird während der Rechtshängigkeit des Restrukturierungsvorhabens durch die (ebenfalls strafbewehrte) Pflicht zur Anzeige des Eintritts einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ersetzt. Nach einer solchen Anzeige hat das Restrukturierungsgericht die Restrukturierungssache in der Regel aufzuheben.
Sanierungsmoderation
Bei der Sanierungsmoderation (§§ 94 ff. StaRUG) handelt es sich um ein von dem Restrukturierungsplan und dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen unabhängiges, nichtöffentliches Verfahren ohne Zwangswirkungen. Es wird ausschließlich auf Antrag des Schuldners eingeleitet und kann auf dessen Wunsch auch wieder beendet werden.
Antragsberechtigt sind restrukturierungsfähige Schuldner, die nicht offensichtlich zahlungsunfähig oder überschuldet sind. Wesentlicher Gegenstand des Verfahrens ist die gerichtliche Bestellung einer sachkundigen Person als Sanierungsmoderator, die als neutraler Dritter zwischen dem Schuldner und den Gläubigern vermitteln soll. Ziel des Verfahrens ist die Herbeiführung einer einvernehmlichen Lösung zwischen den Parteien zur Überwindung der wirtschaftlichen oder finanziellen Schwierigkeiten des Schuldners.
Die Sanierungsmoderation ist insbesondere für Klein- und Kleinstunternehmen geeignet, die zur Sanierung externe Hilfe benötigen.
Das StaRUG – Bedeutung für Schuldner und Gläubiger kurzgefasst
Vorteile des StaRUG für Unternehmen
Ein wesentlicher Vorteil des StaRUG für Unternehmen ist, dass es grundsätzlich als ein nichtöffentliches Verfahren geführt wird, an dem nur die betroffenen Gläubiger und ggf. Anteilseigner beteiligt werden. Das Stigma einer Insolvenz wird damit vermieden. Zugleich sinkt die Abhängigkeit von Gläubigern, die in zwingend notwendigen Restrukturierungen die eigene Position durch die Einnahme von sog. Hold-out-Positionen optimieren wollen.
Eine Sanierung mittels Restrukturierungsplan eignet sich vor allem für Unternehmen, die durch hohe Finanzverbindlichkeiten belastet werden und bei denen eine Refinanzierung durch die hohe Schuldenbelastung erschwert ist. Für operative oder arbeitsrechtliche Sanierungen bietet die Restrukturierung kaum Erleichterungen. Hier ist zu prüfen, ob eine Sanierung mittels eines Insolvenzverfahrens in Betracht kommt.
-> PDF zum Download "Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) und seine Bedeutung für Unternehmen"
Folgen des StaRUG für Gläubiger
Gläubiger müssen bei einer Beteiligung im Rahmen eines Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens mit Einschnitten in ihre Rechte rechnen. Als Beteiligte an einer Gläubigergruppe mit vergleichbaren Rechtspositionen müssen sie – sofern die Mehrheit der Gläubiger in der Gruppe den Restrukturierungsplan annimmt – die geplanten Einschnitte gegen sich gelten lassen. Für ablehnende Gläubiger gilt allerdings der Minderheitenschutz. Ein Restrukturierungsplan wird auf Antrag eines Gläubigers nicht gerichtlich bestätigt – und wirkt damit auch nicht gegen ablehnende Gläubiger – wenn der Gläubiger durch den Restrukturierungsplan voraussichtlich schlechtergestellt wird, als er ohne den Plan stünde. Die Vergleichsrechnung muss also darlegen, dass der Gläubiger jedenfalls keine größeren Einschnitte hinnehmen muss, als ihm auch ohne den Restrukturierungsplan drohen würden.
-> PDF zum Download "Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) und seine Bedeutung für Gläubiger"
Pflichten durch das StaRUG für Organe
Das StaRUG verpflichtet Geschäftsleiter zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement. Den Überwachungsorganen (Aufsichtsrat / Beirat) haben sie entsprechend Bericht zu erstatten. Auch diese müssen dafür Sorge tragen, dass Systeme zur Krisenfrüherkennung im Unternehmen implementiert und regelmäßig aktualisiert werden und dass bei Erkennen einer Krise rechtzeitig gegengesteuert wird.
-> PDF zum Download "Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) und seine Bedeutung für Organe"
Bedeutung des StaRUG für Gesellschafter
Das StaRUG schafft eine Möglichkeit zum Schuldenschnitt auch gegen den Willen einzelner Gläubiger. Dies kann auch (Minderheits-)Gesellschafter betreffen. Es ist zu beachten, dass ein Schuldenschnitt von Banken gegen deren Willen in der Regel nur erreicht werden kann, wenn Gesellschafter keine Werte behalten.
-> PDF zum Download "Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) und seine Bedeutung für Gesellschafter und Aufsichtsratsmitglieder"
Weitere PDFs zum Download
- Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) und seine Bedeutung für Mietverhältnisse in der Krise des Mieters
- Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen aus Sicht der Finanzgläubiger
Unsere Expertise im Bereich Restrukturierung und Insolvenz – Ihr Vorteil
CMS verfügt über langjährige, ausgewiesene Expertise und Erfahrung sowohl mit der vorinsolvenzlichen Beratung von Unternehmen als auch im Insolvenzverfahren. Dem Thema des präventiven Sanierungsverfahrens haben wir uns im Zuge der Diskussionen über die EU-Restrukturierungsrichtlinie intensiv gewidmet und die Umsetzung in das deutsche Recht mit zahlreichen Fachbeiträgen und in Fachveranstaltungen begleitet.
Bei der Entscheidung, ob und inwieweit das StaRUG für Ihr Unternehmen den geeigneten Instrumentenkasten zur Überwindung einer außergewöhnlichen Situation ist, beraten unsere Anwälte für Restrukturierung und Insolvenz Sie jederzeit gerne.
In den Blick nehmen unsere Restrukturierungsexperten für Sie insbesondere die folgenden Aspekte:
- Restrukturierungsmöglichkeiten in verschiedenen Krisenstadien: Sanierungsvergleich, Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, Insolvenzverfahren (in Eigenverwaltung und mit Schutzschirm)
- Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens: Voraussetzungen, Verfahrensablauf, Wirkungsweisen
- Vor- und Nachteile der präventiven Restrukturierung nach dem StaRUG im Vergleich zu den übrigen Restrukturierungsmöglichkeiten
- Zeitliche Anforderungen an Restrukturierungsvorhaben
- Implementierung von Krisenfrüherkennungssystemen entsprechend den neuen gesetzlichen Anforderungen
Wenn Sie Fragen zum Thema StaRUG haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an Alexandra Schluck-Amend.
Insights in Unternehmensstrukturierung nach StaRUG
Lokale Marktkenntnisse. Globale Perspektive.
Wir bieten zukunftsorientierte Rechtsberatung für den Erfolg Ihres Unternehmens. Durch die Kombination lokaler Marktkenntnis mit globaler Perspektive und Anwälten an Standorten auf der ganzen Welt, profitiert Ihr Unternehmen von der Expertise, die Sie benötigen - auch über Grenzen hinweg.
Über CMS