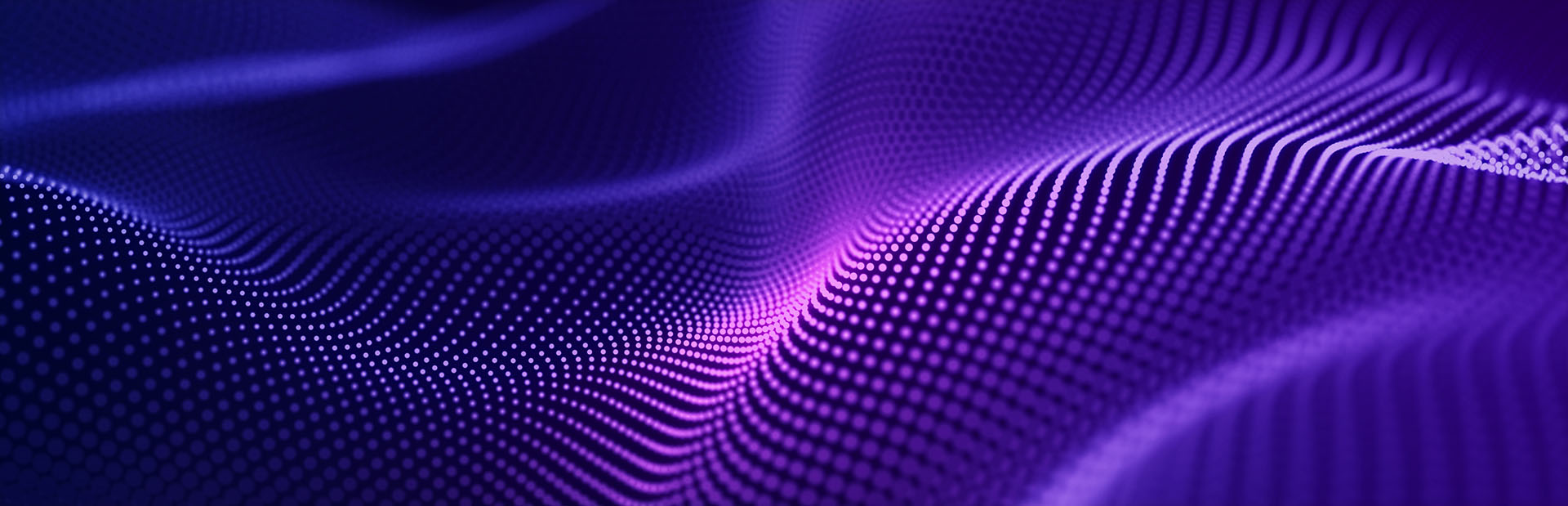Die Frage, ob Verstöße gegen die DSGVO von Mitbewerbern oder Verbänden unter Berufung auf Wettbewerbsrecht abgemahnt werden können, beschäftigt mittlerweile die Gerichte zahlreicher Länder. In Österreich hat sich der Oberste Gerichtshof jüngst erstmals mit dieser Frage auseinandergesetzt und sie mit äußerst knapper Begründung verneint (OGH 26.11. 2019, 4 Ob 84/19k).
Datenschutz als Ausschließlichkeitsrecht?
Aus unserer Sicht ist die Entscheidungsbegründung nicht nachvollziehbar und wirft mehr Fragen auf als sie beantwortet. Bemerkenswert ist, dass sich der OGH überhaupt nicht mit der vor allem in Deutschland rege geführten Diskussion zu diesem Thema, ob die DSGVO ein abschließenden Sanktionsregime vorsieht und daher eine Sperrwirkung gegenüber dem UWG entfaltet, auseinandersetzt. Vielmehr verweist er lapidar auf seine Rechtsprechung, wonach ein Eingriff in Ausschließlichkeitsrechte Dritter, der keine amtswegige Ahndung nach sich ziehe und keine schützenswerten Belange der Allgemeinheit betreffe, grundsätzlich nicht als unlautere Geschäftspraktik in der Fallgruppe Rechtsbruch geltend gemacht werden könne. Das Recht auf Datenschutz sei nach Ansicht des OGH ein solches Ausschließlichkeitsrecht; Verletzungen könnten daher nur vom Betroffenen selbst geltend gemacht werden.
Die vom OGH zu seiner bisherigen Rechtsprechung gezogenen Parallelen überzeugen nicht. Er vergleicht Eingriffe in das Recht auf Datenschutz mit solchen in Ausschließlichkeitsrechte, wie das Urheber-, Marken-, Patent- oder Eigentumsrecht. Eingriffe in solche Rechte können nach der Rechtsprechung des OGH nicht von Wettbewerbern geltend gemacht werden, weil es sich nicht um allgemein verbindliche Verhaltensnormen für jedermann handelt. Mit einem Eingriff würden nur individuellen Interessen des unmittelbar Betroffenen verletzt. Schützenswerte Belange der Allgemeinheit, welche eine amtswegige Ahndung nach sich ziehen, seien dagegen nicht betroffen.
Warum das Urteil des Obersten Gerichtshofs nicht überzeugt
Die DSGVO enthält für jedermann verbindliche Normen, deren Nichtbeachtung nicht nur die Interessen der Betroffenen verletzt, sondern Unternehmen einen erheblichen Vorsprung im Wettbewerb verschaffen kann, z.B. durch Erschließung eines größeren Kundenkreises, Monetarisierung von Daten oder Ersparnis von Aufwendungen. Verstöße gegen die DSGVO sind mit hohen Strafen sanktioniert und können neben dem gerichtlichen Rechtsschutz für den Betroffenen auch von den Datenschutzbehörden amtswegig verfolgt werden.
Das Recht auf Datenschutz ist auch kein Ausschließlichkeitsrecht, weil es der Betroffene als Rechteinhaber bspw. im Unterschied zum Markenrecht gerade nicht zwingend in der Hand hat, die Verarbeitung seiner Daten zu verbieten. Für die Verarbeitung stehen nämlich neben der Einwilligung des Betroffenen auch andere Eingriffsgrundlagen in das Recht auf Datenschutz, insbesondere die berechtigten Interessen des Verantwortlichen, zur Verfügung. Die Argumentation des OGH ist aber auch verfehlt, da das Datenschutzrecht gerade den Schutz der Belange der Allgemeinheit zum Gegenstand hat, weil sämtliche personenbezogenen Daten jeder natürlichen Person nach der DSGVO geschützt sind. Zudem belegen die zahlreichen von der Datenschutzbehörde von Amts wegen eingeleiteten Verfahren, dass Verstöße gegen das Datenschutzrecht auch amtswegig verfolgt werden.
Widerspruch zu bisheriger Judikatur
Das rezente Judikat des OGH birgt aber auch einen systematischen Widerspruch zur bisherigen Judikatur des OGH, die einen abmahnfähigen Wettbewerbsverstoß bei „Cold Calling“ oder „Spamming“ bejaht. Nun implementieren aber die Bestimmungen des TKG 2003 zum Schutz vor unerwünschten werblichen Anrufen und Nachrichten die ePrivacy-RL, welche wiederum eine lex specialis zur DSGVO ist. Es liegt somit ein kaum auflösbarer systemimmanenter Widerspruch vor, wenn die DSGVO ein nur vom Betroffenen geltend zu machendes Ausschließlichkeitsrecht sein soll, Verstöße gegen die Spezialbestimmungen des TKG 2003 aber nach ständiger Rsp des OGH von Mitbewerbern aufgegriffen werden können.
Interessant ist auch, dass der OGH noch im Jahr 2014 einen Verstoß gegen die Meldepflicht nach dem DSG 2000 als einer Abmahnung durch einen Mitbewerber zugänglich sah. Allerdings verneinte er im konkreten Fall einen Wettbewerbsverstoß mangels spürbarer Auswirkungen auf den Wettbewerb. Nach unserer Ansicht sollte auch bei Verstößen gegen die DSGVO die Spürbarkeit das maßgebliche Abgrenzungskriterium sein, d.h. es sollten all jene Verstöße wettbewerbsrechtlich nach der Fallgruppe Rechtsbruch abgemahnt werden können, die dem Verletzer einen Vorteil im Wettbewerb gegenüber gesetztestreuen Unternehmen verschaffen.
Datenschutz vs. Wettbewerbsrecht: Weitere Entscheidungen stehen an
Es ist davon auszugehen, dass in dieser Angelegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. So bejahten zahlreiche deutsche zweitinstanzliche Gerichte bereits grundsätzlich die Abmahnbarkeit von Verstößen gegen die DSGVO nach Wettbewerbsrecht. Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat kürzlich im Verfahren zu I ZR 186/17 wegen Datenschutzverstößen durch Facebooks „App-Zentrum“ allerdings Zweifel im Hinblick auf die Abmahnbarkeit von Verstößen gegen das Datenschutzrecht angemeldet. In einer Pressemitteilung des BGH heißt es: „Möglicherweise lässt die Datenschutz-Richtlinie eine Verfolgung von Verstößen allein durch die Datenschutzbehörden und die Betroffenen und nicht durch Verbände zu.“
Der BGH hat das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH zu „Fashion ID“ unterbrochen. Diese liegt mittlerweile vor, beantwortet aber die Frage, ob Mitbewerber Datenschutzverstöße nach dem UWG geltend machen können, ebenfalls nicht. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich der BGH zu dieser Frage äußern wird. Zwar betrifft das Verfahren noch die Rechtslage zur Datenschutz-Richtlinie, die Rechtsgrundlagen und Datenschutzprinzipien sind aber der DSGVO sehr ähnlich, weswegen eine Aussage zu dieser Frage auch für die geltende Rechtslage relevant wäre.
Die Urteilsverkündung des BGH wird für den 11.4.2020 erwartet.